
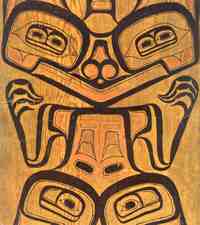



|
"Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze,
träumt im Tier, wacht auf im Menschen"
Sollen Beziehungen von Mystik und Schamanismus untersucht
werden, so ist zunächst zu definieren, was unter Mystik überhaupt
zu verstehen ist. Bei dem hier intendierten Vergleich werde ich die Mystik
repräsentativer Hochreligionen wie Christentum und Buddhismus den
mystischen Aspekten des Schamanismus gegenüberstellen. Der Begriff
Mystik hat seinen Ursprung im Griechischen Verb "myein" = sich
schließen, zusammengehen. Eine andere Bedeutung ist verbunden mit
Begriffen wie "Geheimnisvolles", "Dunkles", "das
den Sinnen und der Vernunft verschlossene". In dem hier verwendeten
Sinne meint Mystik anschließend an den mittelalterlichen Sprachgebrauch
die Erfahrung einer Versenkung der Seele in ihren göttlichen Grund,
die innerlich einigende Begegnung mit der den Menschen und alles Seiende
begründenden göttlichen Unendlichkeit (sog. "Unio Mystica").
Im Christentum, dem Islam und dem Judentum wird diese vornehmlich erfahren
als die Vereinigung mit einem persönlichen Gott. Somit soll hier
Mystik als eine Form religiösen Erlebens verstanden werden, die durch
Versenkung in die innere oder äußere Welt mittels kultischer
Mittel die Herbeiführung entsprechender seelischer Erlebnisse anstrebt,
um auf diese Weise das Einswerden der Einzelseele mit dem Göttlichen
zum unmittelbaren Erlebnis zu machen.
Um das mystische Erleben genauer zu beschreiben und einzugrenzen, werde
ich mich im folgenden auf die Typologie universaler Merkmale mystischen
Erlebens durch den anerkanntermaßen grundlegenden Ansatz des amerikanischen
Philosophen Stace (1960) beziehen. Dieser beschreibt als die wesentlichen
Elemente des mystischen Erlebnisses:
1. Transzendieren der Subjekt-Objekt Relation. Hierunter
sind Einheitserlebnisse zu verstehen, in denen der Betreffende den Unterschied
von Ich und Umwelt nicht mehr erfährt; es kommt gleichsam zu einem
Verschmelzen des Ichs mit der Umwelt. Der mittelalterliche Mystiker Meister
Eckhart prägte die Formel "Alles ist Eines und Eines ist Alles"
für diese Erlebnisse.
2. Transzendenz von Raum und Zeit. Während des mystischen
Erlebnisses kommt es zu einem Verschwinden der Zeitempfindung; beschrieben
häufig als Empfindung der "Ewigkeit", zeitlosen Glücks
usw. Außerdem scheinen Vergangenheit und Zukunft nicht mehr von
Bedeutung zu sein und es kommt zum Empfinden des "absoluten Augenblicks";
auch beschrieben als Vereinigung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Das Transzendieren des Raumes will besagen, daß die Person während
des Erlebens die gewöhnliche Orientierung i.S. einer dreidimensionalen
Wahrnehmung der Umgebung verliert; erfahren wird dies als Erlebnis der
"Unbegrenztheit".
3. Tief empfundene positive Stimmung. Die tragenden Gefühle
mystischer Erlebnisse werden beschrieben als Freude, Seligkeit, Liebesempfindungen
und innerer Frieden. Die sie auszeichnende Intensität hebt sie auf
die höchste Stufe menschlicher Erfahrungen. überdies sind die
Erinnerungen an sie ungewöhnlich lebhaft und intensiv.
4. Gefühl der Heiligkeit. Das "Gefühl der
Heiligkeit" ist eine nicht rationale, intuitive, Schweigen herbeiführende,
Gefühlsempfindung voller Ehrfurcht und Erstaunen gegenüber beseligenden
Gegebenheiten.
5. Empfindung der Objektivität und Wirklichkeit. Diese
Kategorie hat zwei aufeinander bezogene Momente: 1. auf einer intuitiven,
nicht-rationalen Ebene erfühlte Erleuchtung bzw. wissender Einblick,
der durch direktes Erleben gewonnen wird und 2. den Gültigkeitsanspruch,
d.h. die unmittelbare Gewißheit, daß solches Wissen wirklich
wahr ist im Gegensatz zu dem Gefühl, daß das Erlebnis eine
subjektive Täuschung ist. Was gewußt wird, wird intuitiv als
maßgebend gefühlt, bedarf also keines Beweises auf rationaler
Ebene und ist begleitet von einem Gewißheitsgefühl objektiver
Wahrheit.
6. Paradoxie. Beschreibungen mystischen Erlebens haben die
charakteristische Eigenschaft sich als logisch widersprüchlich zu
erweisen. Beim Erleben innerer Einheit geht z.B aller empirischer Gehalt
in einer leeren Einheit verloren, die zugleich angefüllt und vollständig
ist. Das "Ich" existiert (z.B. als das Erlebnis erinnerndes)
und existiert doch nicht.
7. Unaussprechbarkeit. Die Mystiker bestehen darauf, daß
das mystische Erleben nicht in Worten ausgedrückt werden kann. Der
Grund dafür mag in einem Denken und Verbalisierungen hinter sich
lassenden Charakter des überwältigenden Erlebnisses und seiner
widersprüchlichen Natur zu suchen sein. Die Mystik, die der Philosoph
Eduard von Hartmann als letzten und tiefsten Urgrund aller Religiösität
bezeichnet, "weil in ihm die Religion ihre Fundierung und Selbstgewißheit
hat", ist nachweislich als Erfahrungstatsache und Bestandteil selbst
ursprünglichster Religiösität in erstaunlicher Übereinstimmung
weltweit verbreitet. So bescheinigt der Orientalist Gelpke: "Vergleicht
man die Berichte von Mystikern aus den verschiedenen Jahrhunderten und
Kulturen miteinander, so wird man feststellen, daß sie bei formaler
Unterschiedlichkeit inhaltlich übereinstimmen" (Gelpke 1969:
202).Nach einem religionsgeschichtlich begründeten Ansatz des Oxforder
Religionswissenschaftlers Zaehner (1960) lassen sich drei Formen der Mystik
aufgrund ihres Eingebundenseins in jeweils unterschiedliche Gottesvorstellungen
differenzieren. So unterscheidet er:
1. die Naturmystik;
2. die monistische Mystik und
3. die theistische Mystik.
Um diese Formen näher zu charakterisieren, lasse ich
hier einige Beispiele folgen. Zunächst eines für ein Erlebnis
der Naturmystik: "Werde ich je wieder so wunderbare Träume haben
damals ... im Gebirge zur Zeit der Mittagssonne oberhalb von Lavey, als
ich unter einem Baum und drei Schmetterlinge mich umspielten. Und noch
einmal in der Nacht an der sandigen Küste des Ozeans, als ich im
Sand auf dem Rücken lag und mein Auge die Milchstraße verfolgte.
Großartige, weite, unsterbliche kosmogonische Träume: man reicht
bis zu den Sternen und ist im Besitz des Unendlichen! Göttliche Augenblicke,
Stunden des Entzückens, in denen unsere Gedanken von einer Welt zur
anderen fliegen und das große Rätsel durchdringen, da unser
Sinnen so ruhig und tief ist wie das Meer und so still und endlos ...
wie das Firmament ... Augenblicke eines unmittelbaren Anschauens, in denen
man sich so groß wie das Universum und so erhaben wie Gott fühlt
..."(Amiel 1883: 43f.). Und noch ein Weiteres: "Es war, als
hätte ich nie zuvor erkannt, wie lieblich die Welt war. Ich legte
mich auf den Rücken in das warme feuchte Moos und hörte dem
Gesang der Lerche zu ... Keine andere Musik hatte mir je solche Freude
gemacht wie dieser leidenschaftliche Jubelgesang.Es war eine Art hüpfende,
überströmende Verzückung, ein heller, flammengleicher Klang,
jubelnd in sich selbst. Und dann kam eine merkwürdige Erfahrung über
mich. Es war, als ob alles, das vorher außerhalb und um mich herum
zu sein schien, plötzlich in mir sei. Die ganze Welt schien in mir
zu sein. In mir wiegten die Bäume ihre grünen Kronen, in mir
sang die Lerche, in mir schien die heiße Sonne und in mir war der
kühle Schatten. Eine Wolke stieg am Himmel auf und zog mit einem
leichten Regenschauer vorbei, der auf die Blätter trommelte, und
ich fühlte, wie die Frische in meine Seele fiel, und in meinem ganzen
Sein spürte ich den köstlichen Geruch der Erde, von Gras, Pflanzen
und dunkelbraunem Acker. Ich hätte vor Freude schluchzen können"
(Reid 1902). Diese Beispiele machen deutlich: die Naturmystik ist das
Erleben der Einheit von Ich und Welt. Die Welt wird als Teil des expandierten
Ichs erfahren. Man ist von daher geneigt, die Naturmystik als Höhepunkt
eines Gefühls der Naturverehrung oder Naturvergötterung zu betrachten.
In der monistischen Mystik dagegen zieht sich das Ich bewußt von
der durch die Sinne vermittelten Naturwelt zurück. Diese Form hat
sich besonders in der östlichen Mystik herausgebildet. Im Yoga etwa
liegt die Seligkeit in der endgültig geglückten Isolierung des
Geistes von der Sinneswelt, das heißt in der ausschließlichen
Betrachtung der Seele durch sich selbst. Weltanschauliche Widerspiegelung
findet das im Vedanta: Brahman ist das Absolute, die Seele des Menschen
ist von ihrem Wesen her mit dem Absoluten identisch, d.h. die Wirklichkeit
des Geistes ist die einzige Wirklichkeit, unabhängig von Raum, Zeit
und Kausalität. Die sichtbare Sinnenwelt ist dagegen Täuschung
und Illusion: Sie hat keine wirkliche Existenz. Um ein derartiges mystisches
Erleben in seiner Eigenart zu verdeutlichen, sei der englische Mystiker
Symonds zitiert: "Es war ein allmähliches und doch schnelles
Verschwinden von Raum, Zeit, Empfindung und all den anderen Erfahrungen,
die das ausmachen, was wir so gern unser Selbst nennen. In dem Maße
aber, wie diese Bedingungen des gewöhnlichen Bewußtseins schwanden,
gewann das Gefühl von einem tiefer liegenden Bewußtsein an
Kraft. Schließlich blieb nichts übrig als das reine, absolute
Ich. Die ganze Außenwelt verlor Gestalt und Inhalt ... die Rückkehr
in den gewöhnlichen Bewußtseinszustand setzte damit ein, daß
ich die Sinnesempfindung wiedererlangte und daß dann allmählich
aber schnell die bekannten Eindrücke und täglichen Interessen
wieder erwachten" (Brown 1895: 29ff.). Der japanische Zen-Meister
Yamada Kyozo beschreibt das Erleuchtungserlebnis des "Satori"
als "... das Erlebnis, daß das Ich und das All absolut eins
sind. Man erkennt, daß alles, Ich und das, was um mich ist, leer
ist. Alle Dinge sind nur Erscheinungen. ... Während der Erleuchtung
gibt es kein Gefühl, da man in dem Moment nicht mehr existiert. Man
hört nichts und man sieht nichts. Man erlebt keine Erweiterung des
Ichs, keine Verschmelzung mit dem All; sondern das All und das Ich sind
plötzlich eins" (Schüttler 1974: 49f.).Das Ziel der östlichen
monistischen Mystik ist demnach die unbedingte Konzentration auf den reinen
Geist und ineins damit die Abkehr von allem, was nicht dieser Geist ist,
denn das Göttliche und die menschliche Seele sind identisch die erfahrbare
Außenwelt dagegen Illusion. Zaehner bezeichnet alle mystischen Strömungen,
in denen sich der menschliche Geist auf eine einzige (innere oder äußere)
Wirklichkeit beschränkt, als monistische Mystik. Die theistische
Mystik, die hier nur kurz gestreift werden kann, intendiert und erfährt
nicht die Vereinigung mit einem göttlichen Urgrund im mystischen
Erlebnis, sondern vernimmt darin vielmehr die Vereinigung mit einem persönlichen
Gott. Sie ist im Christentum, dem Judentum und Islam ausgeprägt.
Diese Anschauung setzt einen persönlichen Gott voraus, der das Universum
erschaffen hat, und zu den menschlichen Einzelseelen in einem besonderes
Verhältnis steht. Er ist allerdings keinesfalls identisch mit der
Einzelseele oder der Natur. In der christlichen Mystik bleibt von daher
das Bewußtsein der Geschöpflichkeit gegenüber dem Schöpfer
gewahrt. Hingabe an ihn wird nie zu völliger Identifizierung mit
ihm, wohl aber zu höchster Geborgenheit in ihm. Ein Beispiel dafür
liefert deutsche mittelalterliche Mystiker Heinrich Seuse: "... Der
gute und getreue Knecht wird eingeführt in die Freude seines Herrn:
Da wird er trunken von dem unermeßlichen Überfluß des
göttlichen Hauses. Denn ihm geschieht in unaussprechlicher Weise
... daß er nicht mehr sein Selbst ist, daß er sich ganz seines
Selbst entäußert und sich ganz in Gott verloren hat ...,wie
ein kleines Tröpflein Wasser, das man in viel Wein gegossen hat.
Wie das Tröpflein Wasser seine Eigenschaft verliert, so daß
es Farbe und Geruch des Weines annimmt und in sich zieht, so geschieht
denen, die im Vollbesitz der Seligkeit sind: Ihnen gehen alle menschlichen
Begierden verloren, sie gehen sich selbst verloren und tauchen ganz in
den göttlichen Willen ein" (Seuse 1966: 340f.). Um weitere Anhaltspunkte
für einen Vergleich von Hochmystik und Schamanismus zu gewinnen,
werde ich Stace folgend eine weitere Unterteilung einführen. Es handelt
sich um eine Typologie der Mystik die sich die dominierende Gerichtetheit
des Erlebens zur Grundlage macht. Demnach lassen sich zwei Formen unterscheiden:
1. eine "extrovertierte Mystik" und 2. eine "introvertierte
Mystik". Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden liegt darin,
daß sich das extrovertierte Erlebnis durch die Sinne nach außen
richtet, während sich das introvertierte nach innen auf den Geist
hin orientiert. Beide gipfeln in der Wahrnehmung einer höchsten Einheit
und der Empfindung des Menschen, daß er selbst damit verschmilzt
oder sogar identisch wird. Aber der extrovertierte Mystiker nimmt die
Vielheit der äußeren Gegenstände in einer mystisch verwandelten
Weise wahr: durch die Vielheit hindurch erscheint ihm der Einheitsgrund
aller Wesen, so das sich auch das Ich nur mehr vom Sein her fühlt.
Von daher ergibt sich für ihn die feste Auffassung eines einheitlichen
inneren Grundes in allen Dingen, beschrieben als allgegenwärtiges
Leben und Bewußtsein, gepaart mit der Gewißheit, daß
nichts wirklich "tot" ist. Der deutsche Mystiker Jacob Boehme
beschreibt ein solches Erlebnis: "Mit einem großen Sturme ...
brach der Geist durch ... bis in die innerste Geburt der Gottheit und
werde allda von Liebe umfangen. ... Was aber für ein triumphieren
in dem Geiste gewesen sei, kann ich nicht schreiben noch reden, es läßt
sich auch mit nichts vergleichen ... In diesem Lichte hat mein Geist alsbald
durch alles gesehen und an allen Kreaturen, am Kraut und Grass Gott erkannt,
wer er, wie er und was sein Wille war" (Zit. n. Bucke 1925: 131).
Wie dieses Beispiel zeigt, wird das innere Wesen der Objekte intuitiv
erlebt und in seinem Ursprung als gleich erfühlt. Ähnliches
beschreibt der Sioux-Schamane Black Elk bei einer indianischen Visionserflehung:
"Der wichtigste Grund zu flehen ist aber wohl, daß es uns hilft,
unser Einssein mit allen Dingen zu erkennen, zu wissen, daß alle
Dinge unsere Verwandten sind; und dann beten wir im Namen aller Dinge
zu Wakan Tanka, er möge uns die Erkenntnis von ihm geben, von der
Quelle aller Dinge, die doch größer als alle Dinge ist"
(Tedlock 1975: 43).
Der introvertierte Mystiker hingegen sucht in die Tiefen des eigenen Ichs
einzutauchen, indem er die Sinnesempfindungen ausblendet und bewußt
die Vielfalt der Empfindungen, Bilder und Gedanken aus dem Bewußtsein
zu löschen trachtet. In dieser Dunkelheit und Stille nimmt er das
"Eine" wahr und wird mit ihm vereinigt, bar jeglicher Vielheit.
Im Buddhismus wird dies als Bewußtsein des Nichtformbereiches bezeichnet:
"Nach Aussschaltung aller Dingund Formvorstellungen ist der Raum
das unmittelbare Objekt des Bewußtseins. Es hat zwei Eigenschaften:
die der Unendlichkeit und die der Nichtgegenständlichkeit";
beide sind Objekte des intuitiven Bewußtseins (Govinda 1992: 110).
In diesem Zustand des Bewußtseins sind Freiheit, Ruhe und Serenität
verwirklicht. Die Meditation wird als ein Vorgang fortschreitender Vereinheitlichung
verstanden: von der Differenzierung des Oberflächenbewußtseins
(und des dieser Form zugehörigen Ich-Bewußtseins) zur Einheit
des Tiefenbewußtseins. "In der buddhistischen Leere gibt es
keine Zeit. keinen Raum, kein Werden, keine Dinghaftigkeit. Reine Erfahrung
ist, wenn der Geist sich selbst sieht ... Das ist nur möglich, wenn
der Geist ... leer ist von all seinen möglichen Inhalten außer
sich selbst" (Suzuki 1927: 28).
Um den Vergleich von Hochmystik und "schamanistischer Mystik"
leisten zu können, soll zunächst Definitorisches vorrausgeschickt
werden. Unter Schamanismus wird hier eine Ursprungsform der Religiösität
und des Medizinwesens verstanden. Als Schamanen werden gemäß
kulturanthropologischer und religionswissenschaftlicher Definitionen die
religösen Mittler und Heilkundigen der sog. Naturvölker bezeichnet.
Neben einer detaillierten Kenntnis der überlieferten Stammesmythologie
sowie der religiösen Vorstellungswelt und der traditionellen Heilverfahren/pflanzen,
wird ihm insbesondere die Fähigkeit zugesprochen, mittels bestimmter
Kulthandlungen und Techniken in ein breites Spektrum von veränderten
Bewußtseinszuständen eintreten zu können. Aufgrund dieser
Fähigkeit zwischen der alltäglichen Wirklichkeit und den ihr
über und untergeordneten Weltregionen: der Geisterwelt, den Ahnen
und den Naturkräften zu vermitteln (vgl. Eliade 1957; Findeisen 1957;
Halifax 1983). Bei den schamanistischen Praktiken und Ritualen geht es
in erster Linie um die Herstellung bzw. Wiederherstellung von Gleichgewichten
mit/in der umgebenden Natur sowie die Harmonisierung in der Gruppe und
der Einzelseele. In diesem Zusammenhang spielen auch mystische Erlebnisweisen
der im Vorstehenden skizzierten Formen eine Rolle. Das naturmystische
Erleben scheint dabei zu dominieren und bestimmt auch wesentliche Teile
des Naturempfindens und Naturverhältnisses dieser Völker. Trotz
der Schwierigkeit aus den durch kulturspezifische Metaphern verschlüsselten
Erlebnisbeschreibungen explizit mystische Erlebnisse herauszulesen die
zudem in der Literatur selten sind repräsentiert der Schamanismus
"... die glaubwürdigste mystische Erfahrung der Welt der Primitiven.
Innerhalb der archaischen Welt spielt er dieselbe Rolle wie die Mystik
in der offiziellen Religiösität der großen historischen
Religionen vom Buddhismus bis zum Christentum", so der bekannte Religionsgeschichtler
Eliade (1951: 96). Einige Gründe für die Schwierigkeit Beschreibungen
mystischer Erlebnisse, trotz deren grundlegender Bedeutung für die
Weltanschauung der Naturvölker, in der Literatur zu finden, sind
im Folgenden quellenkritisch zu erörtern. Ethnographische Berichte
über den Schamanismus sind größtenteils zu Beginn des
Jahrhunderts verfaßt worden. Sie leiden von daher unter einer damals
weitgehend unreflektierten eurozentristischen Perspektive und sind von
daher mit deren Implikationen für eine Minderbewertung der Lebensauffassungen
sog. "Primitiver" behaftet. Sie dokumentieren nur in seltenen
Fällen originale mündliche Aussagen der Schamanen. Das Schamanen
selbst zu Wort kommen, ist erst in neuester Zeit der Fall (vgl. Halifax
1981). Dazu kommt die Tatsache, daß die "Aushörungen"
durch ethnographische Feldforscher oft von einem Bemühen der Schamanen
bestimmt sind, ihre persönlichen Visionen, und weniger überindividuelle
zudem schwer beschreibbare Erlebnisse zu schildern. Ein weiterer Grund
mag darin liegen, daß die von Schamanen erzeugten "Veränderten
Bewußtseinszustände" (Tart 1969) ein breites Spektrum
verschiedenartiger Zustände umfassen. Insbesondere tranceund traumartige
Erlebnisweisen werden von den Schamanen im Unterschied zur Hochmystik
sehr hoch eingestuft. Auch starke Erregungszustände bis hin zum Halluzinieren
(meist erzeugt durch Trommeln und Tanzen sowie stimulierende Drogenpräparate
(vgl. Rosenbohm 1991)) haben einen wichtigen Platz in schamanistischen
Praktiken und sind weltweit verbreitet. Trotz der Vielfalt der von den
Schamanen erzeugten veränderten Bewußtseinszustände, lassen
sich einige immer wiederkehrende Themenkomplexe bzw. Metaphern innerhalb
dieser Erfahrungswelten im veränderten Bewußtsein mit erstaunlicher
Gleichförmigkeit weltweit nachweisen: Weltenschichtung in Oberund
Unterwelt, Zerstückelungsvisionen, Seelenflug, Gottesanflehung, Ahnenkontakte,
Lebensbaum sowie die Verbindung zu Pflanzenund Tiergeistern. Diese Zentralthemen
verweisen häufig auf Probleme in der Lebenswelt der Naturvölker
(Wetter, Jagdtiere u.ä.). In einem weiteren Sinne würde mancher
Religionswissenschaftler auch Teile solcher Erlebnisse den mystischen
Erlebnissen zurechnen. Aber gemäß dem hier zu Beginn skizzierten
engen Sinn können bestenfalls einzelne Passagen derartiger Erlebnisse
den mystischen Erlebnissen zugerechnet werden. Von daher wird klar, daß
im Schamanismus nicht nur ein breiteres Spektrum von Bewußtseinszuständen
eröffnet und genutzt wird, sondern auch die daraus hervorgehenden
Erlebnisse anderen regulativen Funktionen als die der Hochmystik dienen.
Obgleich meist eingebunden in andere Formen veränderten Wachbewußtseins,
spielen mystische Erlebnisse anscheinend durchaus eine tragende Rolle
in vielen Formen des Schamanismus und stimmen in wesentlichen Punkten
mit den zu Beginn skizzierten Grundelementen mystischen Erlebens überein.
Um das zu belegen, bringe ich im Folgenden einige Beispiele. "Von
einer Sekunde zur anderen war ich hellwach. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit,
Energie und unbeschriebliochem Glück durchströmte mich. Es war
so stark, daß ich außer dieser körperlichen Empfindung
nichts anderes mehr wahrnahm. Eine zeitlang schwebte ich in einer schwarzen
Unendlichkeit, aus der plötzlich, mit der Leuchtkraft von ... Blitzen,
Farben explodierten. ... es war etwas tief in mir drinnen, das lachte.
... Das normale Bewußtsein schien außerhalb von mir zu sein.
... Es hatte keinen Einfluß mehr auf den grenzenlosen Zustand, in
dem ich mich befand" (Haan 1985: 152f.). Eine ähnliche mystische
Vision im Rahmen eines indianischen Huichol-Rituals beschreibt Prem Das:
"Ich verlor das Bewußtsein für meine Umgebung und fiel
in einen dunklen Gang hinein, der spiralförmig nach unten führte,
tief ins innere der Erde. Mir war, als ob ich in Felsritzen und unterirdische
Höhlen hinabsteigen würde, wo es dunkel und abweisend war. Eine
unbekannte Kraft bewegte mich ... ; es war, als würde ich auf einem
reißenden Strom dahintreiben ... Als ich mir sicher war, daß
meine Situation völlig hoffnungslos war und ich nicht mehr zurückkehren
konnte, tauchte plötzliche ein grelles Licht auf. ... Mein Herz hüpfte
vor Freude ... Wärme umhüllte mich und belebte mein Leben neu
..." (Prem Das 1987: 225). Ein weiteres Beispiel liefert der sibirische
Schamane Aua: "Das große Meer hat mich in Bewegung gebracht,
hat mich in Fahrt gebracht. Es treibt mich wie eine Alge im Fluß.
Das Himmelsgewölbe und die gewaltige Luft bewegen mich, sie bewegen
mein Inneres und haben mich mitgerissen, daß ich zittere vor Freude"
(Rinne 1983: 20). Obgleich sich in den Beschreibungen extrovertierte und
introvertierte Mystik zu überschneiden scheinen, ergibt sich doch
bei einer systematischen Durchsicht einer größeren Zahl von
Erlebnisbeschreibungen (vgl. Adami 1983; Passie 1992) unzweideutig die
Tendenz der schamanistischen Mystik zur extrovertierten Richtung. Auch
eine stärkere Mitbeteiligung der Sinne scheint im Unterschied zur
Hochmystik im Schamanismus typisch zu sein. Einen weiteren Beleg mag dafür
auch die Tatsache abgeben, daß schamanistische Rituale häufig
an speziellen, aufgrund bestimmter Eigenschaften für besonders kraftvoll
bzw. heilig erachteten, Naturplätzen abgehalten werden (Swan 1989;
Myerhoff 1980; Sharon 1980). Im Spektrum der von den Schamanen zugänglich
gemachten Bewußtseinserlebnisse haben mystische Erlebnisweisen sicherlich
einen hohen Rang, machen aber dennoch nur einen begrenzten Ausschnitt
aus. Allerdings werden bei bestimmten Gruppenritualen wie dem Peyote-Kult
(La Barre 1989; Myerhoff 1980) und der Ayahuasca-Religion (MacRae 1992)
solcherart mystische Erlebnisse nicht nur von den Schamanen, sondern auch
einem Großteil der Normalpopulation gezielt angestrebt. Sie vermitteln
Gefühle der Geborgenheit, des Aufgehobenseins in der Welt der natürlichen
Kräfte und fördern so die innere Harmonisierung der Einzelseele
wie auch den Zusammenhalt der Gruppe. Aus der über diese Erlebnisse
vermittelten Verankerung im Transzendenten gewinnt der Schamane bzw. die
Teilnehmer der Rituale Kraft und Vertrauen, um die Unbilden der alltäglichen
Wirklichkeit zu ertragen und lernend zu überwinden. Schon aufgrund
des in entsprechenden Naturvölkern viel stärkeren Ausgesetztseins
gegenüber den Naturgewalten ergibt sich sowohl eine ausgeprägte
Zngstigung des Menschen durch das Ausgeliefertsein an die Naturkräfte,
als auch die Notwendigkeit ihre ungerichteten Kräfte zu besänftigen
und symbiotisch zu nutzen. Insofern sind der angstmindernde Aspekt mystischen
Erlebens sowie eine darüber vermittelte Förderung der Gruppenkohäsion
in seiner Bedeutung größer als bei den Hochreligionen einzuschätzen.
Mystisches Erleben gemahnt die Menschen somit an ihre unverbrüchliche
Einheit mit der Natur. Von daher könnte es sogar einen prägenden
Einfluß auf das Naturverhältniss dieser Menschen gewinnen,
indem es ihnen trotz stets präsenter Bedrohung durch die ungezügelten
Naturgewalten ein Gefühl seliger Geborgenheit im Schoß der
Natur vermittelt. Insbesondere im Peyote-Kult der nordamerikanischen Indianer
gewinnt diese Tendenz eine hochkomplexe ritualisierte Gestalt. "Während
der Peyote-Jagd wird Wirikuta als Ort des Beginns und als Zustand der
Einheit wiedererlangt. ... Diese Vereinigungen geschehen gleichzeitig
auf mehreren Ebenen: Auf der gesellschaftlichen Ebene werden ... soziale
Schranken transzendiert, wenn der Marakame (Huichol-Schamane) und seine
Gruppe ein einziges Wesen werden ... sogar biologische Unterschiede zwischen
männlich und weiblich, alt und jung, verschwinden, da Männer,
Frauen und Kinder gleichwertig und vollständig teilnehmen ... Erschreckt
und erhoben durch diese Freiheit, die seit dem Augenblick vor der Geburt
... nicht mehr erfahren wurde, stehen sie nackt nebeneinander, undefiniert,
verwundbar und rein menschlich.
Die reine Landschaft wird geheiligt, die Höhlen, Quellen, Berge,
Flüsse, Kakteenhaine, und die Züge der mythischen Welt werden
zur kosmischen Bedeutung erhoben. 'Pflanzen' und 'Tiere' werden zu bloßen
Etiketten, sbereinkünften, menschlichen Denkkategorien. Unterschiede
zwischen ihnen sind Illusion. Der Mensch ist Natur, er ist eine Ausdehnung
von ihr.... Die Bedingung der Sterblichkeit wird transzendiert und dem
Menschen ozeanische Seligkeit und Allmacht zurückgegeben. ... Für
einen Moment ist das Paradies der menschliche Ursprung. ... Er ist der
Kosmos, ohne Haut und Membran, ohne ein Ich, das ihn hält und trennt.
Er erreicht die ekstatische Durchdringung aller Grenzen" (Myerhoff
1980: 175f.). Auch diese Beschreibung verdeutlicht nochmals die Naturverbundenheit
und den auf Sinneswahrnehmungen beruhenden extrovertierten Charakter eines
Großteils der "schamanistischen Mystik". Die Hochmystik
scheint dagegen, nicht zuletzt aufgrund ihrer anderen sozialen Funktion
und Einbettung, eine ganz spezifische Form mystischen Erlebens die hier
als "introvertiert" beschriebene monistische und theistische
Mystik kultiviert zu haben. Das systematische Streben in Richtung auf
"Erleuchtung" bleibt hier meist Mitgliedern einer sozial abgehobenen
Gruppe vorbehalten (Priester, Mönche usw.). Diese durchlaufen einen
systematischen Schulungsweg, der zu immer größerer Näherung
an das Numinose, bis hin zum mystischen Erleuchtungserlebnis, führen
soll. Individuelle Heilung und Harmonisierung sind zwar auch hierbei wichtige
Ziele, beziehen sich aber auf Nächstenliebe, Einvernehmen mit Gott,
eigene innere Erlösung und weniger auf konkrete Konflikte und Disharmonien
des sozialen Zusammenlebens, anderer Individuen, des Verhältnisses
zu den Ahnen oder des Gesamtverhältnisses Mensch Natur. Die Beziehung
zur Natur spielt in den konkreten Lebensverhältnissen dieser Menschen
(auch geographisch-klimatisch) nur (noch) eine untergeordnete Rolle und
tritt somit auch in den Erlebnissen der introvertierten Mystiker kaum
noch in Erscheinung. Die erstrebte höchste Erfahrung hat im Unterschied
zum Schamanismus einen ganz spezifischen Charakter und alle andersartigen
Bewußtseinserlebnisse werden als Störungen oder Vorstufen angesehen.
Was die im Titel ausgesprochene Frage angeht, ergibt sich aus der vorstehenden
Darstellung ergibt sich, daß im Schamanismus mystische Erfahrungen
durchaus eine nicht nur periphere, sondern vielleicht sogar zentrale Rolle
spielen können. Der Vergleich mit der sog. Hochmystik zeigt, daß
dabei jeweils spezifische Formen mystischer Erlebnisweisen im Vordergrund
stehen: In der Hochmystik eine kultivierte und auf die Erfahrung des reinen,
allumfassenden Bewußtseins zielende monotheistische oder theistische
Mystik der introvertierten Richtung. Im Schamanismus scheint demgegenüber
eine Naturmystik der extrovertierten Richtung zu dominieren.Diese Feststellungen
können allerdings nur Schwerpunkte und Tendenzen markieren, da sich
das Problem vielfältiger Überschneidungen stellt. Kaum ein anderer
als der transkulturell versierte Religionsgeschichtler Eliade dürfte
mehr berufen sein die bei allen Differenzen grundsätzliche Universalität
mystischen Erlebens abschließend zu betonen: "Bei den 'primitiven'
Völkern, genauso wie bei den Heiligen und den christlichen Theologen,
ist die mystische Ekstase eine Rückkehr ins Paradies, die sich durch
Überwindung von Zeit und Geschichte ausdrückt ... und eine Wiederentdeckung
des ursprünglichen Zustandes des Menschen darstellt" (Eliade
1960: 75).
Literaturverzeichnis
Adami, N. (1983): Schamanismus-Bibliographie. Teil 1: Allgemeine
Literatur. In: Bochumer Jahrbuch für Ostasienforschung 6: 98-186.
Albrecht, C. (1951): Psychologie des mystischen Bewusstseins. Bremen.
Amiel, F. (1883): Fragments d'un Journal Intime. Bd. I.
Brown, H.F. (1895): J.A. Symonds. A Biography. London.
Bucke, R.M. (1925): Kosmisches Bewusstsein. Celle. Eliade, M. (1951):
Einführende Betrachtung über den Schamanismus. In: Paideuma
5: 87-97. Eliade, M. (1957): Schamanismus und archaische Ekstasetechnik.
Zürich.
Eliade, M. (1960): The Yearning for Paradise in Primitive Traditon. In:
Murray, H.A. (Hrsg.): Myth and Mythmaking. New York, S. 61-75.
Findeisen, H. (1957): Schamanentum. Stuttgart.
Friedrich, A. / Budruss, G. (1955): Schamanengeschichten aus Sibirien.
München-Planegg.
Govinda, L.A. (1992): Die Dynamik des Geistes. Bern/München/Wien.
Gelpke, R. (1969): Drogen und Seelenerweiterung. München. Haan, Prem
Lelia de (1985): Bei Schamanen. München. Halifax, J. (1981): Die
andere Wirklichkeit der Schamanen. Bern/München.
Halifax, J. (1983): Schamanen. Frankfurt/M. Halifax, J. (1989): Schamanenreise,
buddhistischer Weg. In: Doore, G. (Hrsg.): Opfer und Ekstase. Freiburg/Br.,
S. 283-292.
Heigl, P. (1980): Mystik und Drogenmystik. Düsseldorf.
Hozzel, M. (1977): Magie und Bewußtseinswandel in anthropologischer
Sicht. Heidelberg
Diss. phil. James, W. (1920): Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit
3. Aufl. Leipzig.
Kunisch, H. (Hrsg.) (1958): Eckhart / Tauler / Seuse: Ein Textbuch aus
der altdeutschen Mystik. Hamburg.
Kaltenbrunner, G.K. (Hrsg.) (1976): Die Suche nach dem anderen Zustand:
Wiederkehr der Mystik? Freiburg/Basel/Wien.
Keilbach, W. (1973): Religiöses Erleben. München/Paderborn/Wien.
La Barre, W. (1989): The Peyote Cult. 5th ed. Norman/London. Langen, D.
(1963): Archaische Ekstase und asiatische Meditation. Stuttgart.
MacRae, E. (1992): Guiado pela Lua: Xamanismo e Uso Ritual da Ayahuasca
no Culto do Santo Daime. Sao Paulo (Brasilien).
Mattiesen, E. (1925): Der jenseitige Mensch. Eine Einführung in die
Metapsychologie der mystischen Erfahrung. Berlin/Leipzig.
Myerhoff, B. (1980): Der Peyote Kult. München.
Nicholson, S. (Hrsg.) (1987): Shamanism: An Expanded View of Reality.
Wheaton/Madras/London.
Nioradze, G. (1925): Der Schamanismus bei den sibirischen Völkern.
Stuttgart.
Otto, R. (o.J.): Das Heilige. München.
Passie, T. (1992): Schamanismus Eine kommentierte Auswahlbibliographie.
Hannover.
Schenk, A. / Kalweit, H. (Hrsg.): Heilung des Wissens. München, S.
212-226.
Reid, F. (1902): Following Darkness. London.
Rinne, O. (Hrsg.) (1983): Wie Aua den Geistern geweiht wurde: Geschichten,
Märchen und Mythen der Schamanen. Darmstadt/Neuwied.
Ritter, J. / Gründer, K. (Hrsg.) (1984): Historisches Wörterbuch
der Philosophie. Bd. 6. Basel/Stuttgart.
Rosenbohm, A. (1991): Halluzinogene Drogen im Schamanismus. Berlin.
Schmidt, P.W. (1954): Der Ursprung der Gottesidee Bd. XI: Die asiatischen
Hirtenvölker. Münster.
Schüttler, G. (1968): Das mystisch-ekstatische Erlebnis. Systematische
Darstellung der Phänomenologie und des psychopathologischen Aufbaues.
Bonn: Diss. med. Schüttler, G. (1974): Die Erleuchtung im Zen-Buddhismus.
Freiburg/München.
Schultes, R.E. / Hofmann, A. (1980): Pflanzen der Götter. Bern.
Seuse, H. (1966): Deutsche mystische Schriften. Düsseldorf.
Sharon, D. (1980): Magier der vier Winde. Freiburg/Br.
Sheldrake, R. (1987): Society, Spirit & Ritual. Morphic Resonance
and the Collective Unconscious II. In: Psychological Perspectives 18:
320-331.
Stace, W.T. (1960): Mysticism and Philosophy. New York/Philadelphia.
Struve, W. (1969): Philosophie und Transzendenz. Freiburg/Br.
Suzuki, D.T. (1927): Mysticism: Christian and Buddhist. New York.
Swan, J. (1989): Heilige Orte in der Natur. Eines der Instrumente aus
dem schamanistischen Medizinkoffer. In: Doore, G. (Hrsg.): Opfer und Ekstase.
Freiburg/Br., S. 218-229.
Tart, C. (Hrsg.) (1969): Altered States of Consciousness. New York/London.
Tedlock, D. / Tedlock, B. (Hrsg.) (1980): über dem Rand des tiefen
Canyon. Lehren indianischer Schamanen. Düsseldorf/Köln.
Underhill, E. (1928): Mystik. München. Zaehner, R.C. (1960): Mystik:
Religiös und Profan. Stuttgart
|
 |





