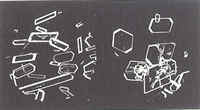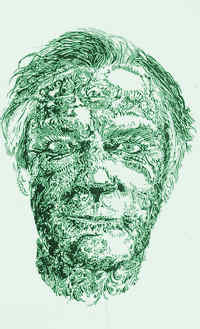| |
Psilocybin in der Psychotherapie
von Dr. Torsten Passie
|
|

Molekulare Formel von Psilocybin
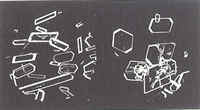
Psilocybin- und Psilocin-Kristalle
|
1. Einleitung
Die Verwendung von Halluzinogenen oder als "Psycholytika" (Sandison)
bezeichneten Substanzen wie Meskalin und LSD im Rahmen moderner psychotherapeutischer
Verfahren reicht bis in die fünfziger Jahre zurück und wurde
zunächst hauptsächlich von der Verwendung des LSD geprägt
(vgl. Abramson 1960; 1967; Passie 1997). Erst zu Beginn der sechziger
Jahre wurde das kurz zuvor in mexikanischen Pilzen entdeckte und kurz
darauf synthetisierte Psilocybin (4-phosphoryloxy-N,N-dimethyl- tryptamin)
(Hofmann et al. 1958; 1959) unter dem Namen Indocybin Sandoz in diese
Verfahren einbezogen. Das praktisch nur in Europa verwendete Psilocybin
wurde vor allem als Hilfsmittel zur Aktivierung unbewußten Materials
im Rahmen tiefenpsychologischer Behandlungen eingesetzt ("Psycholyse").
Dieses Verfahren nutzt die Eigenschaft halluzinogener Substanzen eine
Stimulation der Affektivität und einen traumartigen Erlebnisfluß
bei klarem Bewußtsein und gutem Erinnerungsvermögen zu erzeugen.
In diesem können unbewußte Konflikte und Erinnerungen erlebt
und psychotherapeutischer Bearbeitung zugänglich gemacht werden.
Aber nicht die pharmakologischen Effekte erzeugen die therapeutische Wirkung,
sondern vielmehr erst die langfristige therapeutische Durcharbeitung des
freigelegten Materials. Mittels dieser pharmakologisch unterstützten
Methode konnten sogar vordem als therapieresistent betrachtete Patientengruppen
psychotherapeutisch behandelt werden.
Das Psilocybin und sein kurzwirkendes Derivat CZ 74 (4-hydroxy-N-diäthyltryptamin)
(Hofmann 1959; Leuner et al. 1965; Baer 1967a,b) zeichnen sich - nach
übereinstimmenden Beobachtungen der Autoren - durch Eigenschaften
wie kurze Wirkungsdauer, geringe neurovegetative Nebenwirkungen, wenig
Depersonalisationserleben und Angstprovokation sowie eine stabiler positive
Tönung des affektiven Erlebens aus. Da es somit einen schonenderen
und besser steuerbaren Rauschablauf als das vorher dominierende LSD bietet,
erscheint es als Mittel der Wahl für zukünftige Arbeiten mit
der psycholytischen Therapie (vgl. Leuner 1968, 1981).
Bezüglich ihres Einsatzes in der Psychotherapie werden hier vier
Verfahrensweisen dargestellt, mit denen etwa 1500 Patienten behandelt
wurden. In der Diskussion werden Ähnlichkeiten und Differenzen von
traditionellen und modernen Anwendungsformen herausgearbeitet. |
|

Der allgegenwärtige Psilocybin-Pilz Spitzkegeliger Kahlkopf (Psilocybie
semilanceata) |
2. Frühgeschichte
des Psilocybingebrauches
In dem Monumentalwerk des spanischen Franziskanerpaters
Bernhardino de Sahagun aus dem Jahre 1598 mit dem Titel "Historia
general de las cosas de Nueva Espana" finden sich Beschreibungen
von Eingeborenen der neuen Welt, die während religiöser Feste
bestimmte berauschende Pilze zu sich nahmen. Diese Rituale erschienen
den inquisitorischen Geistlichen der alten Welt als Teufelswerk. Die Eingeborenen
vernahmen dagegen in der Wirkung der Pilze eine direkte Wirkung Gottes
und bezeichneten ihn von daher als "Teonanacatl", den "göttlichen
Pilz" (Wasson 1958). In der gleichen Quelle finden sich Hinweise,
daß die Pilze nicht nur zu religiösen Festen, sondern auch
von Medizinmännern im Rahmen von Heilbehandlungen verwendet wurden.
Die Einnahme der Pilze verlieh ihnen demnach gewisse seherische Kräfte,
die
es ihnen ermöglichten, sowohl die Ursachen von Krankheiten zu erkennen
als auch Wege zu ihrer Heilung zu weisen.
Im Rahmen derartiger schamanistischer Heilbehandlungen werden sowohl psychologische
als auch soziale Konfliktsituationen der Patienten behandelt. Die therapeutischen
Sitzungen vollziehen sich meist in Gegenwart auch von Verwandten des Patienten,
die selektiv in den Verlauf der Behandlungszeremonie einbezogen werden.
Die Pilze werden dabei oft auch alleine vom Heiler zu diagnostischen Zwecken
gegessen. Aber auch die gemeinsame Einnahme mit dem Patienten sowie gelegentlich
auch mit anwesenden Verwandten scheint recht häufig vorzukommen.
Letzeres geschieht, um nicht nur Charakter und Ursachen der Erkrankung
zu diagnostizieren, sondern die Sensibilisierung im veränderten Bewußtsein
zugleich für heilerische Katharsis und Beeinflussung zu nutzen (Wasson
1980; Passie 1985, 1987). Durch die Einbeziehung von Familienangehörigen
und Verwandten gewinnt das Geschehen außerdem wichtige psychodramatische
Akzente.
Die ersten modernen psychopharmakologischen Untersuchungen des Psilocybins
wurden schon in den Jahren 1958 bis 1960 vorgelegt (Delay et al. 1959a,c;
Rümmele 1959; Quetin 1960). Berichtet wurde über ein den bekannten
Halluzinogenen LSD und Meskalin nahestehendes Wirkungsbild mit traumartigen
Erlebnisabwandlungen, Steigerungen des sensorischen Erlebens bis zu Illusionen
und Pseudohalluzinationen, ausgeprägter Introversionsneigung, Synästhesien,
Veränderungen des Raum-, Zeit- und Körpererlebens, Depersonalisationserscheinungen
sowie einer unspezifischen Verstärkung affektiver Qualitäten.
Besonders erwähnt wird auch das häufige Wiedererleben affektbesetzter
Erinnerungen mit ausgeprägter emotionaler Beteiligung, welches besonders
prägnant bei neurotischen Versuchspersonen beobachtet wurde (Delay
et al. 1959b,c,; 1961; 1963; Quetin 1960).
Während der sechziger Jahren folgten Untersuchungen unter verschiedenen
Gesichtspunkten durch Forscher unterschiedicher Nationalität (mit
z.T. erheblichen Probandenzahlen (Leary 1961ff.; Salgueiro 1964)). Diese
konnten die oben geschilderten psychopharmakologischen Wirkungen, die
gute Steuerbarkeit des Rauschzustandes und die physiologische Ungefährlichkeit
des Psilocybins bestätigen (Malitz et al. 1960; Hollister 1961; Heimann
1961; Sercl et al. 1961; Rinkel et al. 1961; Nieto Gomez 1962; Leuner
1962ff; Aguilar 1963; Perez de Francisco 1964; Reda et al. 1964; Keeler
1965; Metzner et al. 1963; 1965; Da Fonseca et al. 1965; Steinegger et
al. 1966; Flores 1966; Dubansky et al. 1967a,b; Fischer et al. 1970). |
|

Der Pilzforscher Robert Wasson im Labor von Albert Hofmann bei der Betrachtung
von Psilocybinkritallen |
3. Klinisch-psychotherapeutische
Anwendung
Geschichte der psycholytischen Therapie
Schon im Zusammenhang mit umfangreichen Forschungen zu halluzinogenen
Substanzen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere
dem Meskalin (vgl. Passie 1995a), wurde auf ihre langtradierte Anwendung
in indigenen Heilungsritualen des mittel- und südamerikanischen Raumes
hingewiesen (Beringer 1927; LaBarre 1938). Insofern lag es nahe, ihre
Brauchbarkeit zur Unterstützung psychotherapeutischer Behandlungen
zu prüfen. Doch erst Experimente mit dem 1943 entdeckten hochwirksamen
Halluzinogen LSD (Lysergsäurediäthylamid) (Stoll 1947) gaben
den Anstoß, diese Substanzen bei der Psychotherapie neurotischer
Patienten anzuwenden. Erste Behandlungsversuche führten Busch et
al. (1950) und - im Kontext des psychoanalytischen Verfahrens - Frederking
(1953/54; 1954) durch. Vor allem aber wurde man durch die von der englischen
Gruppe um Sandison et al. (1954ff.) berichteten Zustandsbesserungen neurotischer
Patienten nach einmaliger LSD-Verabreichung auf das Potential dieser Substanzen
zur Förderung psychotherapeutischer Behandlungen aufmerksam.
Einige Forscher hatten zunächst einen pharmakologischen Effekt für
die therapeutische Wirkung verantwortlich gemacht. Es wurde aber schnell
deutlich, daß es sich bei den beobachteten Besserungen keineswegs
um pharmakologisch induzierte Veränderungen handelte, sondern die
hervorgerufenen Erlebnisse sich ohne Einbindung in eine längerfristige
psychotherapeutische Behandlung wenig ergiebig strukturierten und zudem
schnell verflüchtigten. Letztlich wurde den beteiligten Forschern
immer klarer, daß es sich bei diesen Substanzen nur um Hilfsmittel
zur Förderung unbewußten Materials und vertiefter Selbsteinsicht
im Kontext aufdeckender psychotherapeutischer Verfahren handeln kann. |
|
| |
Mechanismen psycholytischer Psychotherapie
Eine Brauchbarkeit zur Unterstützung von Psychotherapie
besitzen Psycholytika wie LSD und Psilocybin durch ihre Eigenschaft einen
traumartigen Erlebnisfluß bei weitgehend klarem Bewußt
sein und gutem Erinnerungsvermögen hervorzurufen. In diesem können
vordem verdrängte unbewußte Konflikte und Erinnerungen aktiviert
und lebhaft wiedererlebt werden. Ausserdem wird häufig eine Lockerung
psychischer Abwehrmechanismen sowie eine Begünstigung psychotherapeutisch
wertvoller regressiver Erlebnisweisen ("Altersregression") beobachtet.
Die Stimulation der Affektivität läßt sowohl vergangene
als auch aktuelle Gefühlsbeziehungen deutlicher erlebbar werden. Auch
die Übertragungsbeziehung erfährt eine Intensivierung, die bis
zu illusionären Gesichts- und Gestaltverkennungen des Arztes gehen
kann. Dem Patienten wird dadurch mit aller Deutlichkeit der projektive Charakter
womöglich infantiler Übertragungen vor Augen geführt.
Weiteres Kennzeichen des Erlebens unter geringen Dosen von Psycholytika
ist eine eigentümliche Distanz mit der der Erlebende bzw. ein "reflektierender
Ich-Rest" (Leuner) dem veränderten Erleben gegenüberzustehen
vermag. Dies garantiert die stete Einsicht des Patienten in den künstlichen
Ursprung seiner Erlebnisveränderungen. Außerdem gelingt es ihm
aus einer Beobachterperspektive, nach dem Prinzip eines Weitwinkelobjektives,
weit auseinanderliegende innerseelische Fakten wie Remineszenzen, menschliche
Gefühlsbeziehungen oder fehlerhafte charakterliche Einstellungen miteinander
in Sinnzusammenhang zu bringen. Dabei sind mehrere Bewußtseinsbereiche
gleichzeitig angesprochen, so daß eine breite Integration unbewußten
Materials gelingt. Der Betreffende kann so eine Fülle introspektiver
Einsichten in neurotische Fehlhaltungen gewinnen. Deren Überzeugungscharakter
ist durch die ausgeprägte emotionale Beteiligung ausgesprochen gut,
so daß der therapeutische Prozeß beträchtlich intensiviert,
beschleunigt und zugleich vertieft wird.
Aufgrund der genannten Wirkungen erschien einer nicht geringen Zahl von
Therapeuten mittels der psycholytischen Methode eine Erweiterung des Indikationsspektrums
der Psychotherapie auch auf vordem für unbehandelbar erachtete schwere
und chronifizierte Neurosen möglich. Die meisten Patienten dieser Gruppe
sind gekennzeichnet durch rigide Abwehr- und Verdrängungsmechanismen,
mangelnde zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit und eine Unfähigkeit
unbewußtes Material durch die üblichen Methoden der "freie
Assoziation", das Traumleben usw. hervorzubringen. Eine aufdeckende
psychotherapeutische Behandlung ist von daher stark behindert bzw. verunmöglicht.
In der durch Psycholytika anregbaren traumartigen Erlebnisveränderung
erkannten deshalb viele Psychotherapeuten ein probates Mittel um auch dieses
schwierige Klientel erfolgreich psychotherapeutisch zu behandeln (Arendsen
Hein 1963).
Im Laufe der folgenden zehn Jahre wurde die Anwendung von Halluzinogenen
in der Psychotherapie schwerer neurotischer Störungen international
geprüft, weiterentwickelt und als klinisches Verfahren etabliert (vgl.
z.B. Sandison et al. 1954ff.; Leuner 1962ff.; Ling et al. 1963; Hausner
et al. 1963ff.; Grof 1967ff.; vgl. auch Abramson 1960, 1967; Passie 1995b,
1997).
Vor der Einführung des Psilocybins dominierte der Einsatz von LSD.
Die ersten Experimente zur psychotherapeutischen Verwendung des Psilocybins
datieren jedoch schon aus den Jahren nach seiner Entdeckung und synthetischen
Reindarstellung 1958-61. Zuerst wurde nur die einfache psychopharmakologische
Wirkung auf einzelne neurotische Patienten - ohne psychotherapeutische Vorbereitung
und Nachbearbeitung der Erlebnisse - untersucht (Delay et al. 1959ff.; Vernet
1960; Quetin 1960; David et al. 1961; Duche 1961, Sercl et al. 1961). Erste
Behandlungen mit Psilocybin im psycholytischen Setting berichtete Leuner
(Barolin 1961: 468; Leuner 1962), der mit seiner Arbeitsgruppe an der Göttinger
Universitätsklinik bis in die achtziger Jahre mehr als 150 neurotische
Patienten langfristig mit Psilocybin bzw. seinem kurzwirkenden Derivat CZ
74 behandelte (Leuner 1981, 1987, 1995; Fernandez Cerdeno et al. 1967a,b).
Als Vorteile des Psilocybins gegenüber dem LSD wurden die kürzere
Wirkungsdauer, weniger neurovegetative Nebenwirkungen, geringere Neigung
zu Depersonalisationserlebnissen, eine stabiler positive Tönung des
Erlebens und eine geringere Bedrängnis beim Wiedererleben von Konflikten
und traumatischem Material beschrieben. Dies lasse das Erleben unter Psilocybin
insgesamt schonender und weniger konfrontativ verlaufen als beim LSD. |
|
| |
Die einzelnen Verfahren
Zur Beschreibung der Anwendungen von Psilocybin in der Psychotherapie
bietet sich eine Unterteilung der Verfahren nach Rahmenbedingungen und
therapeutischem Vorgehen an:
A. Psychoanalytische Individualtherapie mit eingeschobenen ambulanten
oder stationären psycholytischen Einzelsitzungen und deren Nachbearbeitung
im psychoanalytischen Einzelsetting.
B. Ambulante oder stationäre psychoanalytische Einzeltherapie mit
regelmäßigen psycholytischen Einzelsitzungen im stätionären
Rahmen und gruppentherapeutischer Nachbereitung des Erlebten (als Variationsform:
"stationäre Intervallbehandlung").
C. Tiefenpsychologische Gruppentherapien mit eingestreuten psycholytischen
Gruppensitzungen und anschließender Durcharbeitung in der Gruppe.
D. Gruppentherapeutische Vorbereitung und (hochdosierte) Verabreichung
der Substanzen im supportiven stationären Gruppensetting mit "psychedelischer"
Methodik und Zielsetzung.
|
|
| Author |
Methode |
Ritual-
charakter |
Intendierte
Erfahrung |
Sitzungs-
anzahl |
Dosis |
Patienten-
anzahl |
Andere
Substanzen |
Leuner (1962 et seq.)
|
A/B |
+ |
Aktivierung unbewußter Konflikte und Erfahrungen |
10-30 |
|
150 |
LSD / CZ-74 |
Gnirss (1963 et seq.)
|
A |
+ |
'' |
10-30 |
|
25 |
--- |
Aldhadeff (1963)
|
A |
+ |
'' |
1-5 |
|
15 |
LSD |
| Hausner et al. (1963 et seq.) |
B |
+ |
'' |
1-35 |
|
einige Hundert |
LSD |
Massoni et al. (1964)
|
A |
+ |
'' |
Some |
|
92 |
LSD |
Derbolowski (1966)
|
B |
+ |
'' |
1-15 |
|
65 |
LSD |
| Fernandez-Cerdeno (1967) |
A |
+ |
'' |
7-30 |
|
? |
LSD |
Berendes (1979/80)
|
A |
+ |
'' |
? |
|
? |
LSD / DPT |
Johnsen (1967)
|
B |
+ |
'' |
1-3 |
|
12 |
LSD / CZ-74 |
Kristensen (1963)
|
B |
+ |
'' |
5-10 |
|
20 |
--- |
Geert-Jörgensen (1968)
|
A/B |
+ |
'' |
5-15 |
|
150 |
LSD |
Cwynar (1966)
|
? |
+ |
'' |
9-12 |
|
11 |
--- |
Clark (1967/68)
|
A |
+ |
'' |
2-5 |
|
20 |
LSD |
Rydzynski et al. (1978)
|
A/B |
+ |
'' |
12-15 |
|
31 |
LSD |
Hollister et al. (1962)
|
A (?) |
+ |
'' |
? |
|
18 |
LSD / Mescaline |
Fontana (1961 et seq.)
|
C |
++ |
'' |
1-10 |
|
250 |
LSD / Mescaline |
Alnaes (1965)
|
D |
+++ |
Psychedelic ego transcendence |
2-5 |
|
20 |
LSD / CZ-74 |
| Leary et al. (1965 et seq.) |
D |
++ |
'' |
2-3 |
|
40 |
--- |
Roquet et al. (1981)
|
D |
+++ |
''
and selfconfrontation |
5-10 |
|
950 |
LSD /Mescaline
/ Ketamine |
|

Prof. Dr. med.
Hanscarl Leuner (1918-1997)
Leuner war der europäische Pionier der psycholytischen Therapie und
Halluzinogenforschung.
|
Zu A.:
Es handelt sich hierbei um die in erster Linie von Sandison et al. (1954ff.),
Leuner (1959ff.), Hausner et al. (1963ff.), Ling et al. (1963) und Grof
(1967ff.) bis zur klinischen Anwendungsreife entwickelte Methode der Anwendung
von psycholytischen Substanzen im Verlauf von psychotherapeutischen Einzelbehandlungen.
Den Rahmen dieses 1960 von Sandison erstmals als "Psycholyse"
bezeichneten Verfahrens (vgl. Barolin 1961) bildet die psychoanalytische
Einzelbehandlung mit zusätzlichen wöchentlichen bis monatlichen
psycholytischen Sitzungen. Die Erlebnisse aus den psycholytischen Sitzungen
werden dann in drogenfreien Zwischensitzungen anhand von Protokollen und
Erinnerungen durchgearbeitet. Fast immer geht den ersten psycholytischen
Sitzungen eine mehrmonatige psychoanalytische Vorbehandlung voraus. Zur
Anwendung kommen bei diesem Verfahren niedrige Dosen von LSD (50-150mcg)
oder Psilocybin (3-15mg). In den ersten Sitzungen wird mit einer Schwellendosis
begonnen und sukzessive bis auf jene Dosis gesteigert, bei welcher der Patient
die produktivsten Erlebnisverläufe zeigt. Bei adäquater Dosierung
sollte psychodynamisches Erlebnismaterial sowie eine Intensivierung der
Übertragungsbeziehung im Vordergrund stehen. Während der Sitzungen
bietet die permanente Anwesenheit des Therapeuten bzw. eines sog. Hilfstherapeuten
(meist eine speziell geschulte Schwester) schützenden Beistand, ohne
jedoch interpretierend in den Erlebnisverlauf einzugreifen. Gelegentliche
Besuche des behandelnden Arztes im Behandlungsraum ergänzen die Betreuung.
Die Rahmenbedingungen der Sitzungen sind so angelegt, daß der Patient
sich möglichst unbefangen den auftretenden Erlebnissen hingeben kann.
Deren Interpretation und und Integration bleibt den drogenfreien Zwischensitzungen
vorbehalten. Zur diskreten Stimulation des Erlebens wird von fast allen
Autoren eine Abdunkelung des Behandlungsraumes und das Abspielen leiser
Musik empfohlen. Mit dieser Methode wurden in den sechziger Jahren Behandlungserfolge
mit Psilocybin bei mehreren hundert neurotischen Patienten berichtet (Fontana
1961; Heimann 1962; Leuner 1962ff.; Alhadeff 1963a, 1963b; Hausner et al.
1963ff.; Stevenin et al. 1962; Gnirss 1963, 1965; Kristensen 1963; Geert
Jörgensen et al. 1964, 1968; Massoni et al. 1964; Cwynar et al. 1966;
Derbolowsky 1966; Johnsen 1967; Fernandez Cerdeno et al. 1967a; Clark 1967/68;
Berendes 1979/80).
Als geeignete Hauptindikationen werden Charakter-, Angst- und Zwangsneurosen,
neurotische und reaktive Depressionen, Perversionen und Sexualneurosen angegeben.
Kontraindikationen würden hysteriforme Neurosen, Psychosen, Borderline-Fälle
sowie konstitutionell infantile und Ich-schwache Personen darstellen. |
|
| |
Zu B.:
Diese Verfahrensweise wurde zunächst von Sandison et al. (1954ff.)
entwickelt und an einer größeren Zahl von Patienten mit LSD erprobt.
Die weitere Etablierung der Methodik - bei hauptsächlicher Verwendung
von Psilocybin - wurde während der sechziger Jahre von psychoanalytisch
orientierten Therapeuten wie Fontana (1961ff.), Derbolowsky (1966), Hausner
et al. (1963ff.), Geert Jörgensen et al. (1964ff.), Gnirss (1965),
Johnsen (1967), Alnaes (1965) und vor allem Leuner (1962ff.) geleistet.
Im wesentlichen folgt auch dieses Verfahren den unter A. beschriebenen Prämissen.
Auch hier werden die in wöchentlichen bis monatlichen Abständen
vom Therapeuten bzw. Hilfstherapeuten begleiteten psycholytischen Einzelsitzungen
in einen tiefenpsychologischen Behandlungsrahmen integriert. Zur Abwicklung
der Sitzungen werden die Patienten für mehrere Tage in einer Klinik
bzw. Tagesklinik aufgenommen. Unterschiede zu der unter A. beschriebenen
Verfahrensweise bestehen darin, daß die Patienten jeweils vor und
nach den zeitlich parallel in Einzelzimmern stattfindenen psycholytischen
Sitzungen zur tiefenpsychologischen Interpretation und Durcharbeitung in
einer Gruppensitzung zusammenkommen. Hierbei kann der sensibilisierte psychische
Zustand während der abklingenden Wirkung und die Aufgeschlossenheit
unter dem Eindruck des in der Sitzung Erlebten für die Nachbearbeitung
genutzt werden. Im Anschluß daran wird meist eine Möglichkeit
zur Gestaltungstherapie (Malen, Formen von Tonmasse u.a.) geboten, wo die
Patienten ihren Erlebnissen künstlerischen Ausdruck verleihen können.
Am nächsten Tag finden nochmals einzel- und gruppentherapeutische Sitzungen
statt, um die weitere Integration des Erlebten zu fördern. Eine bewährte
Variante dieses Verfahrens stellt die von Leuner (1963ff.), Derbolowsky
(1966), Fontana (1961, 1963), Geert Jörgensen et al. (1964ff.), Alnaes
(1965) und Johnsen (1967) benutzte Methode der "stationären Intervallbehandlung"
dar. Hierbei werden 5-6 Patienten, die sonst ambulant in psychoanalytischen
Einzeltherapien behandelt werden, in regelmäßigen Abständen
für nur 2-3 Tage zur stationär aufgenommen und nach dem oben skizzierten
Verfahren behandelt. Dieses Vorgehen vereinigt die Vorteile einer längerfristigen
ambulanten Psychotherapie mit den Möglichkeiten einer Intensivierung
und Vertiefung durch psycholytische Sitzungen. Außerdem wird die Sicherheit
des Verfahrens durch die gute Überwachungsmöglichkeit während
und nach den Sitzungen erhöht. |
|
| |
Zu C.:
Die Anwendung von Psilocybin und LSD in tiefenpsychologischen Gruppentherapiesitzungen
hat vor allem Fontana (1961, 1963) an mehr als 240 Patienten erprobt.Nachdem
eine feste Gruppe von 7-8 Patienten über mehrere Monate 1-2x wöchentlich
gruppentherapeutisch gearbeitet hat, wird ihnen die Durchführung von
einigen psycholytischen Gruppensitzungen angeboten. Zu den Sitzungen kommen
die Teilnehmer in geeigneten Klinikräumen zusammen und erhalten eine
niedrige Dosis Psilocybin (8-12mg) oder LSD (50-150mcg). Ohne das eine Gruppeninteraktion
gefordert wäre, soll sich jeder Teilnehmer möglichst unbefangen
dem eigenen Erleben hingeben. Allein ihren Bedürfnissen gemäß
sollen die Teilnehmer miteinander in Kontakt treten. Als Sitzungsbegleiter
fungieren der jeweilige Gruppentherapeut und ein zusätzlicher Co-Therapeut,
der aber nur bei auftauchenden Problemen in das Geschehen einzugreifen hat.
Mit einer ähnlichen Methode arbeiteten in jüngster Zeit auch die
Schweizer Psycholyse-Therapeuten (Benz 1989; Styk 1994; Gasser 1995). Besondere
Vorteile des Verfahrens sehen die Anwender in der gruppendynamischen Aktivierung
und Intensivierung von Übertragungsphänomenen und einem dem Patienten
ermöglichten Beobachten und Verstehen eigener Abwehrmechanismen. Außerdem
biete die Gruppe dem Einzelnen eine tragende Struktur und vermindere damit
Ängste und Isolation. Fontana (1963: 944) beschreibt die Dynamik einer
sorgfältig vorbereiteten psycholytischen Gruppensitzung als "...
comparable with that of a musical group, in that the melodies and rythms
of each one serve to form a collective rythm and a complete melody not interfering
with the individual melodies". Trotz der in Gruppensituationen besonders
intensivierten Übertragungsreaktionen seien - bei sorgfältiger
Vorbereitung - während solcher Sitzungen keine Steuerungsschwierigkeiten
aufgetreten (Fontana 1963; Styk 1994; Gasser 1995). Die von Johnsen (1964)
berichteten Schwierigkeiten bei der Gruppenapplikation von Psycholytika:
gesteigerte Konfusion der Gruppendynamik und Beeinträchtigung des Selbsterlebens
beim einzelnen Patienten, sind wohl eher auf die simple Übertragung
gruppentherapeutischer Interaktionsanforderungen auf psycholytische Sitzungen
zurückzuführen. Eine Nachbearbeitung der Erlebnisse aus den Sitzungen
findet im Gruppenrahmen und - wenn erforderlich - auch in Einzelgesprächen
statt.
Fontana (1963: 944) sieht die speziellen Indikationen für eine derartige
Gruppenbehandlung bei Charakterneurosen (Verdeutlichung sonst ichsynton
erlebter Abwehrmechanismen), bei Hypochondrien (eine oft unter Psycholytika
erlebte Dissoziation von Psyche und Soma mache deren Zusammenwirken erfahrbar),
bei Adoleszenten (intensive Konfrontation mit spezifischen Konfliktmustern
der Lebensphase: Beziehungen zur äußeren Welt und Lösung
aus der Mutterbeziehung). Ansonsten gilt der Indikationsbereich für
die unter A. und B. beschriebenen Verfahren. |
|
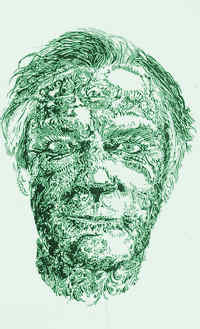
Timothy Leary (1930-2001)
Pionier der Psilocybinforschung an der Harvard Universität (USA) |
Zu D.:
Die Verwendung von hochdosierten Psilocybingaben in Gruppensitzungen zur
Induktion religiöser Erlebnisse mit persönlichkeitsverändernder
Wirkung geht auf die in der Einleitung beschriebenen indianischen Rituale
bei der Verwendung des Peyotl-Kaktus (Meskalin) und des Teonanacatl-Pilzes
(Psilocybin) zurück. Die Gruppe um Leary (Leary 1961ff.; Leary et al.
1963; Metzner et al. 1963, 1965) und auch Pahnke (1962) erforschten in naturalistischen
Settings (Natur, Privatwohnungen, Kirchen) an mehr als hundert gesunden
Freiwilligen die Wirkungen hochdosierter Psilocybinsitzungen. Aufgrund ihrer
Beobachtungen empfanden sie es als naheliegend, die tiefgreifenden Abwandlungen
des Selbst- und Welterlebens unter Psilocybinwirkung zur Förderung
therapeutisch wirksamer Selbsteinsicht bei verhaltensgestörten Probanden
(Gefängnisinsassen) einzusetzen. Man verfolgte dabei die Hypothese,
daß - bei unterstützendem Setting und entsprechender Einstimmung
der Probanden - ".. Psilocybin ... produces a state of dissociation
or detachment from the roles and games of everyday interaction. ... This
can provide insight and perspective about repetetive behaviour or thought
patterns and open up the way for the construction of alternatives"
(Leary et al. 1965: 64; vgl. auch Selbstschilderungen von Teilnehmern: Swain
1963: 240ff.; Castayne 1968). Das von Leary et al. am Concord Prison in
Massachusettes initierte Projekt sollte im Kontext eines 6-wöchigen
Programmes zur Verhaltensänderung neben regelmäßigen gruppentherapeutischen
Sitzungen (unter Prämissen der Transaktionsanalyse) für jeden
Probanden zwei Psilocybinsitzungen von "einsichtsförderndem Charakter"
in einer Kleingruppe beinhalten. Nach der Auswahl der Probanden wurden diese
über Sinn und Zweck des Programmes sowie über die Wirkungen des
Psilocybins aufgeklärt. Nach einigen vorbereitenden Gruppensitzungen
wurde in speziell hergericheteten Räumen des Gefängniskrankenhauses
an eine zuerst 5-10, später nur noch 5 Personen (4 Probanden, 1 Psychologe)
umfassende Gruppe in der ersten Sitzung 20-30mg, in der zweiten Sitzung
50-70mg Psilocybin verabreicht. Im Anschluß an die - gemäß
den Autoren - meist von intensiven Erlebnissen und Selbsteinsichten geprägten
Sitzungen wurden diese in Gruppendiskussionen nachbesprochen. Trotz dieser
Nachbearbeitung wurden einige depressive Nachschwankungen und Schwierigkeiten
bei der psychischen Integration der "psychedelischen" Erlebnisse
beobachtet (Leary et al. 1965: 65). Nach den Autoren wurde bei katamnestischen
Erhebungen eine deutlich reduzierte Rückfallquote, insbesondere was
das erneute Begehen krimineller Akte angeht, bei Teilnehmern der Studie
gefunden (Leary et al. 1968; vgl. auch DOBLIN).
Einen dem Vorgehen von Leary et al. nicht unverwandten gruppentherapeutischen
Ansatz verfolgte der Norweger Alnaes (1965). Er wollte einer Gruppe von
20 psychoneurotischen Patienten, durch einige in einen tiefenpsychologischen
Gruppenprozeß eingestreute hochdosierte Psilocybinsitzungen (20-50mg),
mittels einer "psychedelischen" Erfahrung von Selbsttranszendenz
tiefere Einsichten in eigenes Erleben und Verhalten ermöglichen. Bei
der Vorbereitung und Durchführung seiner Experimente folgte er maßgeblich
den von Leary et al. (1964) entworfenen Konzepten zu psychedelischen Erfahrungsformen.
Nach einer Vorbereitung des Patienten in psychotherapeutischen Einzelsitzungen
wurde den Patienten im Gruppensetting unter supportiven äußeren
Bedingungen (angenehm gestaltete Behandlungsräume mit Bildern, Kerzenlicht
und Musik) Psilocybin bzw. dessen Derivat CZ 74 verabreicht. Am Nachmittag
nach der Sitzung wurden die Erlebnisse im Gruppenrahmen durchgesprochen
und interpretiert. Alnaes berichtet von guten Besserungen seiner Patienten,
ohne allerdings eine genauere Evaluierung zu leisten.
In anderer Weise verwendete der mexikanische Psychiater Roquet Psilocybin
und andere psycholytische Substanzen. Nachdem er seit 1967 bei deren Verwendung
zunächst den Behandlungsrichtlinien von Leuner (1962ff.) gefolgt war,
integrierte er zunehmend bestimmte Praktiken indianischer Heiler und kombinierte
sie mit modernem technischen Instrumentarium zu einer eigenen Methodik (Roquet
et al. 1975, 1981 YENSEN). Nach einer sorgfältigen Vorbereitung der
Patienten durch tiefenpsychologische Gruppen- bzw. Einzeltherapie werden
diese im Laufe eines Behandlungsplanes einer Sequenz von Erfahrungen mit
verschiedenen halluzinogenen Pflanzen bzw. Substanzen im Gruppenrahmen ausgesetzt
(Villoldo 1977: 50). Die Gruppen bestehen aus jeweils 6-35 Patienten. Am
Tag der Sitzung finden sich die Teilnehmer morgens zu Entspannungsübungen
zusammen, um danach in einem mit speziellem Bildmaterial von existentieller
Bedeutung sowie moderner Beleuchtungstechnik ausgestatteten Raumes im Institut
von Roquet die Substanzen einzunehmen. Nach dem Einsetzen der Wirkung werden
die Teilnehmer starken sensorischen Reizen (Geräusche, Musik, Filme,
Dias) ausgesetzt, die mittels ihres Bedeutungsgehaltes während des
sensibilisierten psychischen Zustandes der Teilnehmer ausgeprägte emotionale
Reaktionen hervorrufen. Dieses bewußt erzeugte "sensorische Bombardement"
führt zu einer starken psychischen Irritation, die meist von einem
Zusammenbruch innerpsychischer Abwehrstrukturen und mentaler Konzepte begleitet
ist. Die konfrontative Anlage des Verfahrens zielt auf die Evokation und
Stimulation persönlicher und transpersonaler psychischer Konflikte,
die dann mittels anschließender Psychotherapie in die bewußte
Persönlichkeit integriert werden sollen.
Roquet et al. (1981: 98) behandelten mit diesem Verfahren vor allem Charakterneurosen
(83%), Sexualneurosen und Drogenabhängige. Bei der Behandlung von mehr
als 950 Patienten wurden gemäß einer wissenschaftlichen Nachuntersuchung
bei ca. 80% der Behandelten deutliche Besserungen beobachtet (Roquet et
al. 1981: 103ff.). |
|
| |
4. Diskussion
Das erst Ende der fünfziger Jahre als Inhaltsstoff von mittelamerikanischen
Pilzen entdeckte und kurz darauf synthetisierte Psilocybin wurde schon
kurz nach seiner Entdeckung intensiv auf seine pharmakologischen, somatischen
und psychischen Wirkungen am Menschen untersucht. In den folgenden Jahren
wurden umfangreiche Erfahrungen durch Forscher in aller Welt gesammelt
(vgl. Passie 1995c). Die Anwendung des Psilocybins in der Psychotherapie
zeigte, daß das Psilocybin eine Eignung zur Unterstützung psychotherapeutischer
Behandlungen - vor allem nach der in Europa üblichen "psycholytischen"
Methode - besitzt.
In diesem Kontext konnten auch seine spezifischen Wirkqualitäten
im Unterschied zum LSD genauer herausgearbeitet werden. Die das Psilocybin
auszeichnenden Eigenschaften sind demnach:
1. eine wünschenswerte kürzere Wirkungsdauer;
2. geringere neurovegetative Nebenwirkungen;
3. weniger Depersonalisationserleben;
4. seltenere Angstprovokation;
5. eine stabil positive Tönung des affektiven Erlebens
(Fontana 1961: 97; Kristensen 1963: 178f.; Fisher 1963: 211; Alhadeff
1963a: 245; Massoni et al. 1964: 129; Clark 1967/68: 22; Rydzynski et
al.: 81). Daraus ergibt sich das Bild eines - im Vergleich zu LSD - sanfteren
sowie besser erinnerbaren und integrierbaren Erlebniswandels bei guter
Steuerbarkeit des Rauschverlaufes (Gnirss 1963; Leuner 1968; 1995). Vorteilhaft
ist auch die nur kurze Wirkungslatenz bei intramuskulärer Applikation,
was die Erwartungsspannung des Patienten vermindern hilft (die LSD-Wirkung
entfaltet sich dagegen auch bei intramuskulärer Injektion erst nach
ca. 30 Min. (Leuner 1981: 257; Pahnke 1967: 640)).
Zwei weitere Argumente die für eine Verwendung des Psilocybins bzw.
seines Derivates CZ 74 (4-hydroxy-N-diäthyltryptamin) bei psycholytischen
Therapieverfahrenangeführt wurden, sind das Wegfallen des Suggestivhintergrundes
durch ihre geringe Bekanntheit in der Öffentlichkeit und ihre erschwerte
chemische Herstellbarkeit.
Von Interesse für zukünftige Arbeiten mit der psycholytischen
Therapie könnte, wie schon erwähnt, auch das von Leuner et al.
(1965) und Baer (1967a,b) klinisch geprüfte sowie von Leuner
(1967ff.), Johnsen (1967) und Alnaes (1965) psychotherapeutisch eingesetzte
Psilocybin-Derivat CZ 74 sein. Dieses hat eine Wirkungsdauer von nur ca.
3 Stunden und ist fast völlig frei von somatischen Nebenwirkungen.
Ein verwandtes Tryptaminderivat mit einer Wirkungsdauer von 2-4 Stunden,
nämlich DPT (Dipropyltryptamin) wurde während der letzten Forschungsprojekte
der Baltimore-Gruppe (USA) von Grof (1972/73; Grof et al. 1973) und Soskin
(1975; Soskin et al. 1973) als Alternative zur Verwendung von LSD untersucht.
Auch für ambulante psycholytische Behandlungen schienen den Autoren
diese kurzwirkenden Substanzen gut geeignet (Leuner et al. 1965: 473).
Mindestens die unter A., B. und C. geschilderten Verfahren bei denen Psilocybin
bzw. sein Derivat CZ 74 psychotherapeutisch eingesetzt wurden, sind stark
von den Prämissen und Verfahrensweisen der Freudschen und Jungschen
Psychoanalyse geprägt. Die Psychoanalyse arbeitet schon von je her
mit Methoden, die geeignet sind, traumatische Ereignisse und unbewußte
Konflikte in der Persönlichkeitsentwicklung aufzudecken bzw. bewußt
zu machen. Die hierbei von der Psychoanalyse angewandten Methoden sind
die Hypnose, die Traumdeutung, die "Aktive Imagination" (nach
C. G. Jung), die "freie Assoziation" und das Erleben im Tagtraum
(auch als "katathymes Bilderleben" nach Leuner). Von daher konnte
die Verwendung von Psycholytika, welche introspektives Erleben fördern
und unbewußtes Material aktivieren können, bei psychoanalytisch
orientierten Therapeuten auf fruchtbaren Boden fallen. Sie hat sich deshalb
in diesen Kreisen schnell als experimentelles Verfahren etabliert. Zudem
reichte die Aktivierung unbewußter Konflikte und traumatischer Erinnerungen
in psycholytischen Sitzungen weit tiefer als mit konventionellen Methoden
(vgl. Grof 1978). Dazu kommt die Beobachtung, daß die von Psycholytika
erzeugten Altersregressionen bis in das erste Lebensjahr zurückreichen
können und den Patienten eine äusserst lebhaftes und realistisches
Wiedererleben weit zurückliegender Erfahrungen ermöglichen,
was deren therapeutische Durcharbeitung stark begünstigt (Leuner
et al. 1967b). Somit schien man ein probates Mittel zur Intensivierung
und Beschleunigung der traditionellen tiefenpsychologischen Verfahren
gefunden zu haben, welches die Behandlungsdauer beträchtlich abkürzen
kann. Zudem konnten mittels der pharmakologischen Aktivierung unbewußten
Materials auch vordem als therapieresistent geltende Patienten für
psychotherapeutische Arbeit aufgeschlossen werden (Arendsen Hein 1963;
Leuner 1981). Aufgrunddessen wurde von vielen Therapeuten und Forschern
für diese Substanzen eine vielversprechende Zukunft in der Psychotherapie
vorausgesehen. Diese fand aber angesichts des Ende der sechziger Jahre
aufkommenden massenhaften Gebrauchs der Substanzen durch Laien ein jähes
Ende durch das Verbot seitens der WHO (vgl. Leuner 1981: 17ff.).
Im Folgenden sollen einige Betrachtungen zum Vergleich der traditionellen
und modernen Anwendungsformen von Psycholytika angestellt werden. In der
modernen Psychotherapie wurden die Substanzen weit überwiegend im
Einzelsetting bzw. in Kleingruppen mit nachfolgender Durcharbeitung und
Interpretation genutzt, was einige Verwandtschaft zu traditionellen Verwendungsformen
aufweist (vgl. Wasson 1980; Rosenbohm 1991). Bei den schamanistischen
Heilbehandlungen sollen gleichermaßen unbewußte Konflikte
und krankheitsbezogene Erinnerungen stimuliert, als Krankheitsursachen
erkannt, und mit Hilfe des Schamanen interpretierend aufgearbeitet werden.
Während die klassischen Psycholyse-Therapeuten den Patienten auffordern,
sich den auftauchenden Erlebnissen einfach hinzugeben und sich bemühen
nicht in den Rauschablauf einzugreifen, nutzen viele der indigenen Heiler
den sensibilisierten Zustand ihrer Patienten auch zu prägnanten suggestiv-kathartischen
Interventionen. Das in Europa entwickelte psycholytische Verfahren mit
niedrigdosierten Seriensitzungen nutzt dagegen weniger suggestive und
psychodramatische Möglichkeiten der Behandlung, sondern hebt vielmehr
auf die Aktivierung und Durcharbeitung unbewußter Konflikte und
Erinnerungen ab. Dafür geeignetes Material tritt bei einer im Vergleich
zu traditionellen Anwendungen sehr niedrigen Dosierung vor allem in Gestalt
von Traumfragmenten auf. Diese Traumfragmente haben nachweislich persönlichkeitsbezogenen
Charakter (Leuner 1962) und können von daher sinnvoll in einen tiefenpsychologischen
Therapieprozeß integriert werden. Das psychodramatische Moment fehlt
bei dieser Methode und die Stimulation/Manipulation des Erlebens beschränkt
sich auf das Abspielen leiser Musik in abgedunkelten Räumen. Die
Ichfunktionen bleiben aufgrund minimaler Dosierung und Stimulation großenteils
erhalten und erlauben dem Patienten eine Beobachterperspektive. Ein weiterer
Unterschied zu traditionellen Verwendungen stellt auch die serienmäßige
Verabreichung beim psycholytischen Verfahren dar. Während dabei die
Patienten einer Folge von 10-70 wöchentlichen bis monatlichen Sitzungen
ausgesetzt werden, herrschen bei der traditionellen Verwendung einzelne
konfliktzentrierte Sitzungen mit starken psychodramatischen Elementen
vor. Obwohl auch bei indigenen Heilern Folgesitzungen nicht ganz selten
sind, ist doch die um ein aktuelles Krankheitsgeschehen zentrierte Anwendung
die Regel. Um schon in solchen kurzzeitigen Interventionen einschlägige
Wirkungen erzielen zu können, werden auch suggestive, psychodramatische
und religiöse Aspekte der induzierten Erlebnisveränderungen
genutzt. Die leitenden Schamanen greifen auch viel prägnanter und
massiver in den Verlauf des Sitzungsgeschehens ein, als dies bei den modernen
Psycholyse-Therapeuten der Fall ist. Diese leisten Interpretationshilfe
und therapeutische Durcharbeitung praktisch ausschließlich in drogenfreien
Zwischensitzungen. Auch die von Schamanen genutzte Einbeziehung von Familienmitgliedern
und Verwandten in die Sitzungen verstärkt wahrscheinlich eine durchgreifende
Wirkung vereinzelter Interventionen. Die Ichfunktionen sind durch die
höhere Dosierung und die seltenere Verabreichung im schamanistischen
Kontext starken Fluktuationen ausgesetzt. Im Unterschied zu den Schamanen
konzentrieren sich die Psycholyse-Therapeuten mit ihren Seriensitzungen
auf die Behandlung chronifizierter neurotischer Erkrankungen. Diesen liegen
meist strukturelle Persönlichkeitsverformungen zugrunde, deren Behandlung
nur durch längerfristige Psychotherapie erfolgversprechend ist (Leuner
1981). Unterschiede von traditionellen und modernen Verfahrensweisen lassen
sich auch bezüglich der Tageszeit finden, zu der die Sitzungen abgehalten
werden. Während bei den indigenen Heilern die Sitzungen den Nachtstunden
vorbehalten sind, verabreichen die klassischen Psycholyse-Therapeuten
die Substanzen vormittags, um den Nachmittag für eine Nachbesprechung
nutzen zu können.
Die unter D. dargestellten Verfahrensformen schließen allerdings
in verschiedener Hinsicht unmittelbar an die religiös-kultischen
Verwendungen halluzinogener Substanzen an. Es wird dabei direkt auf religiös-ekstatische
Erlebnisse abgezielt, wie sie bei entsprechender Präparation der
Teilnehmer unter höheren Dosen von Psycholytika häufig zu beobachten
sind (Leary et al. 1963). Solcherart Erfahrungen gehen oft mit Konversionserlebnissen
von persönlichkeitsverändernder Wirkung einher. Dieser Effekt
wurde vor allem von Pahnke (1962) wissenschaftlich belegt und kam in dem
von amerikanischen LSD-Therapeuten entwickelten Konzept der "Psychedelischen
Therapie" zum tragen (Chwelos et al. 1959; Savage 1962; Sherwood
et al. 1962). Das den Probanden dabei gebotene Setting schließt
in vielen Aspekten an Praktiken und Rituale traditioneller indigener Kulte
an: Abgedunkelte und speziell präparierte Räumlichkeiten, quasi-religiöse
Vorbereitung und Einstimmung der Teilnehmer, Schaffung einer Geborgenheit
vermittelnden Gesamtatmosphäre, musikalische Begleitung und Begünstigung
einer starken Verinnerlichung der Erlebnisse (Savage et al. 1967; Lipp
1990; Heim et al. 1958; LaBarre 1938). Eine psychodynamische Interpretation
und Durcharbeitung der Erlebnisse findet im Gegensatz zur pycholytischen
Methode nicht statt. Ein weiterer Unterschied ist darin zu sehen, daß
die klassischen psychedelischen Therapiesitzungen meist im Einzelsetting
bzw. sehr kleinen Gruppen veranstaltet wurden. Die traditionelle vorwiegend
religiös inspirierte Verwendung findet dagegen stets in einem rituell
strukturierten Gruppensetting statt (vgl. LaBarre 1938; Myerhoff 1980).
Während im Einzelsetting der Verlauf des Erlebens maßgeblich
von der Therapeut-Patient-Beziehung geprägt wird, ist bei traditionellen
indianischen Gruppenritualen der Rauschzustand durch die rituelle Struktur
und die gesamte Gruppe ausgesteuert. Die Nacharbeit beschränkt sich
im traditionellen Setting auf eine gemeinsame Diskussion der jeweiligen
Erlebnisse. Ähnlich wie bei den traditionellen Anwendungen werden
auch bei der psychedelischen Therapie nur wenige längerfristig vorbereitete
Sitzungen mit höherer Dosierung durchgeführt (Savage et al.
1965; Grof 1981).
Einer sachgerechten Nachbeobachtung der Teilnehmer (wegen möglicher
Nachschwankungen) werden sowohl die traditionellen Heiler mittels nächtlichem
Setting und erneuter Zusammenkunft am nächsten Tage gerecht, als
auch die Psycholyse-Therapeuten mit ihrer Bevorzugung eines stätionären
bzw. teilstationären Settings (Klinik o. Tagesklinik). Einen schon
von Grof (1967) vorgeschlagenen Ansatz, Vorteile des psycholytischen und
psychedelischen Verfahrens miteinander zu verbinden, verfolgten von den
dargestellten Autoren Alnaes (1963), und Roquet et al. (1981) wie auch
jüngst die Psycholyse-Therapeuten in der Schweiz (Styk 1994; Gasser
1995). Diese Autoren bemühten sich sowohl um die Begünstigung
"psychedelisch-mystischer" Erfahrungsformen in einem dem traditionellen
stark angenäherten Setting (Gruppensitzungen mit höherer Dosierung,
nächtliche Einnahme, rituelle Struktur, naturnahe Settings u.a.)
als auch um eine längerfristige therapeutische Aufarbeitung psychodynamisch-biographischer
Erlebnisbestandteile.
Überblickt man die historische Entwicklung der Verfahrensweisen zur
Nutzung von psycholytischen Substanzen in der modernen Psychotherapie,
so ist eine zweigleisige Entwicklung zu beobachten. Zum einen die Entwicklung
der psycholytischen Methode in Europa, die die Möglichkeiten der
Evokation unbewußten Materials durch Psycholytika in hergebrachte
tiefenpsychologische Behandlungsverfahren einbaute. Und zum anderen die
Entwicklung der psychedelischen Methode, die in vielem unmittelbar an
die traditionellen Settings und Vorgehensweisen anknüpft und quasi-religiöse
Erlebnisse von mystischer Selbsttranszendenz zur Grundlage therapeutischen
Wirkens machte.
Was die Behandlungsergebnisse der geschilderten Anwendungen des Psilocybins
in der modernen Psychotherapie angeht, soll hier nur auf die katamnestischen
Untersuchungen von Mascher (1966), Schulz-Wittner (1989), Leuner (1994)
und der Baltimore-Gruppe (vgl. Yensen et al. 1995) verwiesen werden. Diese
Autoren konnten - in Übereinstimmung mit vielen anderen - über
eine deutliche Besserung bei etwa 65% der behandelten meist schweren und
chronifizierten Neurosen berichten. Ein Teil dieser Evaluierungen erscheint
allerdings problematisch, weil sie vor allem während der sechziger
Jahre (als noch viel mit psycholytischen Substanzen geforscht wurde) durchgeführt
wurden und somit nur den damaligen Standards der Psychotherapie-Evaluation
genüge tun. Aus heutiger Perspektive erscheinen sie von daher mit
z.T. gravierenden Mängeln behaftet (vgl. Pletscher et al. 1994).
Weitere Untersuchungen bzw. Überprüfungen der damals als vielversprechend
gewerteten
Behandlungserfolge mit heutiger Methodik sind unter Einhaltung mindestens
folgender Prämissen wünschenswert:
1. Spezifikation der Diagnosen nach DSM IV/ICD-10;
2. Gebrauch standardisierter Instrumente zur Erfassung der Psychopathologie;
3. Spezifikation der Therapeuten und Environment betreffenden Variablen;
4. Operationalisierung der Outcome-Variablen und
5. Einführung von Kontrollgruppen.
"... It is hoped that with a better methodology and standardization
and, hopefully, with international cooperation, a protocol on psychotherapeutic
/ psychopharmacological procedures will allow this work to continue"
(Ladewig 1994: 228). In diesem Sinne wurde von Mitgliedern der Schweizerischen
Ärztegesellschaft für Psycholytische Therapie (SAEPT) in den
letzten Jahren der Plan für eine wissenschaftliche Untersuchung zur
Wirksamkeit einer durch Psilocybin unterstützten Psychotherapie erarbeitet.
Diese Untersuchung sieht eine psycholytische Behandlung einer von depressiven
Patienten vor und ist als randomisierte dreifach-blinde Studie konzipiert.
Sie geht in ihrer wissenschaftlichen Konzeption noch deutlich über
die oben genannten Forderungen hinaus. Erst von dieser aufwendigen und
grundlegenden Untersuchung ist eine sichere Antwort auf die Frage nach
einer besonderen Effektivität der psycholytischen Behandlung zu erwarten.
Allerdings weisen die Ergebnisse einer retrospektiven Befragung unter
Patienten, die während der Jahre 1988-1993 eine legale psycholytische
Therapie durch Ärzte der SAEPT erhalten haben, eine große Zufriedenheit
mit der Behandlung, deren Ergebnissen und ein erstaunlich geringes Gefahrenpotential
hin (GASSER 1999).
|
|
| |
5.
Literatur >>
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|